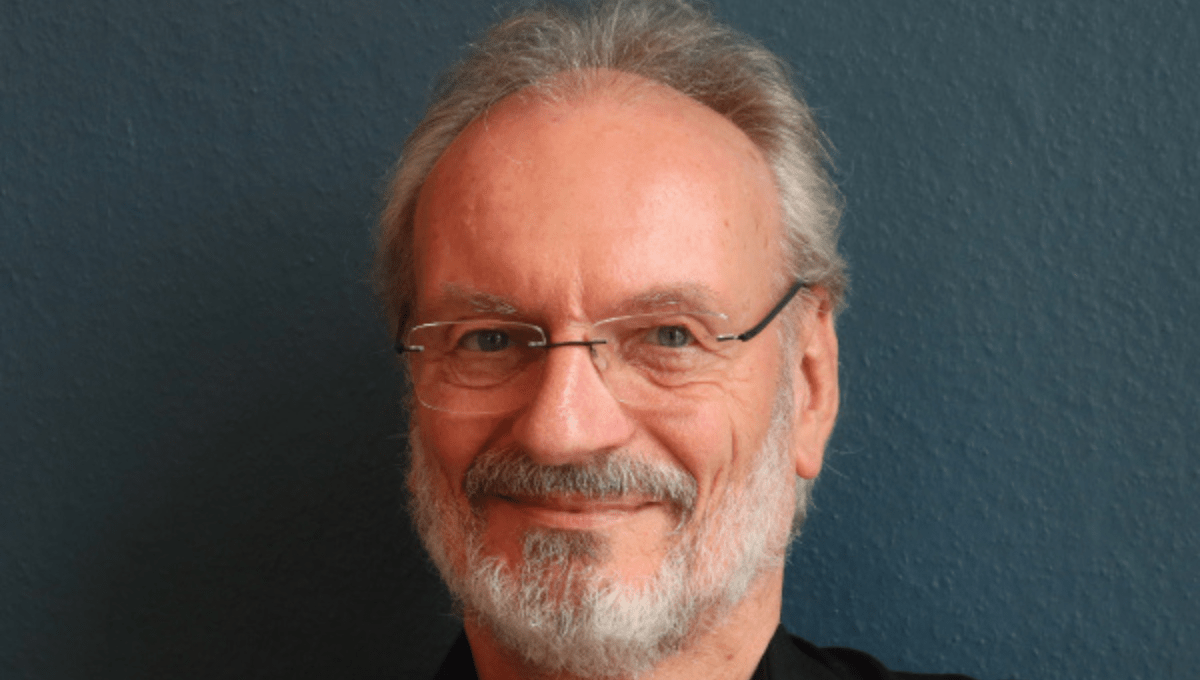Herr Fischer, seit 2008 gibt es Ihren Verband. Was waren damals die Gründe, um „wir pflegen“ ins Leben zu rufen?
Das allererste Treffen von pflegenden Angehörigen und auch wissenschaftlich und beruflich an der Pflege Interessierten war im Herbst 2007 in Hamburg. Das war ein wichtiges Treffen von Akteuren, ich war damals als Geschäftsführer einer Organisation für pflegende Angehörige in Schottland eingeladen. Schottland hatte damals in über zehn Jahren bereits viel für pflegende Angehörige erreicht und deshalb war ich als Referent eingeladen, um zu zeigen, was möglich ist.
Seitdem sind 16 Jahre vergangen. Was hat sich thematisch verändert?
Pflegende Angehörigen haben heute zwar ein höheres Ansehen, die Herausforderungen, vor denen sie stehen, sind jedoch stark gewachsen. Es gibt einen demografischen Wandel, aber auch die Familienstrukturen haben sich geändert. Es gibt heute nur wenige Familien, in denen nicht beide Partner berufstätig sind. Das ist zum Teil wirtschaftlich bedingt, hat aber auch mit einem anderen Selbstverständnis zu tun.
Sie meinen, die Bereitschaft Angehörigenpflege zu übernehmen, ist nicht mehr so stark vorhanden?
Doch, das schon, aber nicht bis zur völligen Selbstaufgabe. Frauen und Männer haben heute auch sehr qualifizierte Ausbildungen und wollen in ihrem Beruf arbeiten. Und dazu kommt, dass Familien heute nicht mehr so viele Kinder haben wie früher oder diese weiter entfernt leben.
Solange Angehörige in Deutschland und in allen europäischen Ländern gezwungen sind, unbezahlt und schlecht versorgt weit über 80 Prozent der Pflegeleistung zu übernehmen, sehe ich meine Aufgabe darin, einen Beitrag zur strategischen Entwicklung der Interessenvertretung von Angehörigen zu leisten und die Entlastung von Familien in eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung zu bringen.
Und was bedeutet das konkret für die Arbeit des Vereins?
Diejenigen, die heute familiale Pflege übernehmen, sind sehr belastet. Wir brauchen eindeutig bessere Entlastungsangebote. Damit meine ich auch, dass diese kurzfristig verfügbar, örtlich erreichbar und finanzierbar sind. Es darf keine Armut durch Pflege geben. Und ich erinnere daran, dass Pflege keine individuelle, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Das ist sogar gesetzlich in SGB XI, §8 festgeschrieben. Und darauf arbeiten wir als Verband hin.
Somit rücken Sie also das Thema der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf in den Mittelpunkt.
Ja, aber das Thema war schon immer da. Es begleitet uns seit Verbandsgründung. Allerdings ist das Bewusstsein um die Problematik viel größer geworden, auch wegen der Notwendigkeit, Fachkräfte in den Betrieben zu halten. Vereinbarkeit ist das Resultat und Ergebnis gesamtgesellschaftlicher Maßnahmen von Politik, Arbeitgebern, Kommunen, Familie, u.a., die ineinandergreifen und sich ergänzend unterstützende und entlastende Maßnahmen bereitstellen. Und da kommt erneut das Thema Entlastung ins Spiel. Ganz, ganz wichtig ist die Regulierung der Pflegezeit und die Auszeiten. „Vereinbarkeit“ ist die Möglichkeit, berufliche Tätigkeit und die pflegerische Versorgung so zu verbinden, dass An- und Zugehörigen selbstbestimmt Zeit zur Erhaltung der psychischen und physischen Gesundheit, Erholung, Regeneration und Freizeitausgleich bleibt, die für Personen ohne Pflegeverantwortung als selbstverständlich gilt.
Dazu braucht es auch Strukturen, die eine Entlastung möglich machen.
Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege – man gibt dem ja allem verschiedene Namen und wahnsinnig bürokratische Strukturen, aber am Schluss sind es Auszeiten. Das ist die Zeit für sich selbst, die Zeit, sich zu erholen, so wie Sie und ich Jahresurlaub haben. Weil heute der Zugang zu Entlastungsangeboten weit schwieriger ist als noch vor einigen Jahren, wird leider Vereinbarkeit von Beruf und Pflege immer häufiger als Prozess verstanden, der zu einer „Arbeits- und Pflegeverdichtung“ führt – mit Ziel einer volkswirtschaftlichen Maximierung der Produktivität, also der Erledigung beruflicher und pflegerischer Aufgaben in derselben Zeit, die eine nicht-pflegende Person für Beruf, Familie und Lebensausgleich hat. Dagegen müssen wir uns wehren.
Wie tun Sie das?
Wir gehören schon fünf oder sechs Jahre dem Beirat zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf an und identifizieren uns mit seinen Forderungen. Wir stehen sehr für das Thema Einkommensersatz für pflegende Angehörige ein, aber das wollten zuerst die Arbeitgeber und nun das Finanzministerium nicht mittragen. Somit verstehe ich unsere Rolle zunehmend als Gewerkschaft des 21. Jahrhunderts für Menschen, die unbezahlte Pflege leisten.
Sie haben derzeit einen Mitgliederstand von „unter 500“, wie Sie selbst angeben.
Die Zahlen beschreiben die formelle Mitgliedschaft in unserem Verein. Dazu kommen jedoch Tausende von Unterstützern, also Menschen, die beispielsweise unseren Newsletter abonniert haben, sich bei unserer App registriert haben und aktiv in unseren Netzwerken mitwirken.
Sebastian Fischer (67) ist Mitglied im geschäftsführenden Vorstand von „wir pflegen e.V.“ und stammt aus Esslingen in Baden-Württemberg. Schon in seiner Kindheit erlebte er in der eigenen Familie Pflegesituationen mit. Als Student zog er nach Großbritannien und lebte in London, seit 1990 dann in Schottlands Hauptstadt Edinburgh. Dort war er 30 Jahre lang hauptberuflich an der Entwicklung von Verbänden, Interessenvertretungen und einem Netzwerk von regionalen Pflegestützpunkten für pflegende Angehörige beteiligt.
In Deutschland begleitet Fischer die Entwicklung des Vereins „wir pflegen e.V.“ seit 2007 in verschiedenen Vorstandspositionen und als Vorstandsmitglied von „Eurocarers“ (www.eurocarers.org). Seit seiner Pensionierung lebt Sebastian Fischer nicht nur in Edinburgh, sondern großteils auch in Berlin.
Kontakt:
wir pflegen e.V.
www.wir-pflegen.net
E-Mail: info@wir-pflegen.net
Tel: (030) 45 97 57 50
Warum ist es so schwierig, pflegende Angehörige, von denen es ja bundesweit geschätzt über vier Millionen gibt, in einem Verband zu bündeln?
Zum einen fehlt oft die Selbstidentifikation als „pflegende Angehörige“. Dann treten Menschen meist in einen Verein ein, um Freizeit zu gestalten oder Interessen zu teilen. Das ist mit dem Thema Pflege schon mal nicht gegeben. Zudem sind wir kein Verein, der direkte Pflegeentlastung anbieten kann. Das können wir nicht leisten. Wir können bestenfalls Wissenstransfer der Betroffenen und damit Informationen, Solidarität und emotionale Entlastung bieten und Ratgeber sein – über unsere gemeinschaftlichen Selbsthilfeangebote und Netzwerke. Um sich in einem Verein zu engagieren, braucht man Zeit. Das ist etwas, von dem pflegende Angehörige zu wenig haben. Pflegesituationen sind einfach zu unterschiedlich und spezifisch. Wir versuchen, unsere Angebote nach thematischer Betroffenheit zu gruppieren, beispielsweise nach Pflegesituationen.
In welchen Bundesländern gibt es Landesvereine Ihres Verbandes?
Wir haben bisher Landesvereine in Berlin, Thüringen, Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. In Sachsen befinden wir uns gerade in der Gründungsphase.
Sie suchen sich Aktionspartner, zum Beispiel den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa). Was versprechen Sie sich von einer Kooperation mit einem Berufsverband der professionellen Pflege und wie sieht die Zusammenarbeit aus?
Wir haben im August eine gemeinsame Kampagne gestartet unter dem Motto „Bei Anruf Sorry“. Dazu hat der bpa seine gut 13.000 Mitgliedsunternehmen, also Pflegedienste, Pflegeheime und Tagespflegen, aufgerufen, über vier Wochen zu erfassen, wie viele Anfragen nach einer pflegerischen Versorgung sie ablehnen müssen. Im Durchschnitt musste jede Einrichtung drei Mal täglich „Sorry“ sagen. Das macht deutlich, wie schwer es für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen ist, Unterstützung zu finden. An dieser Stelle vertreten wir das Interesse der Menschen in Pflegesituationen, die sich durch die hohen Eigenanteile keine Entlastung leisten können oder keine Pflegedienste finden. Der bpa macht wiederum auf die Not seiner Mitglieder aufmerksam, dass nicht ausreichend Personal vorhanden ist und es keine umfassende Refinanzierung der Angebote gibt. Der Schritt zu einer gemeinsamen Kampagne mit dem bpa ist uns jedoch nicht leichtgefallen.
Warum nicht?
Wir sind der Auffassung, dass man aus der Not der Menschen eigentlich keine Profite für Aktionäre schlagen darf. Und wir sind uns im Klaren darüber, dass wir Kritik ausgesetzt sind, wenn wir mit dem Verband der privaten Anbieter gemeinsame Sache machen. Aber wir leben nun mal in einer Gesellschaft, die marktwirtschaftlich orientiert ist, und noch nicht in einer Gesellschaft, in der Pflege als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden wird. Somit müssen wir alle den Mut aufbringen, Pflege neu zu denken und neue Wege zu gehen, um die derzeitige Misere des Pflegesystems deutlich zu machen.
Ein Motto des Verbandes lautet „von der Selbsthilfe zur Selbstvertretung“. Wie bereiten Sie Ihre Mitglieder darauf vor, und warum ist es wichtig, in die Selbstvertretung zu kommen?
Wir vertreten die gemeinschaftliche Selbsthilfe und unterstützen dabei, Solidarität zu entwickeln. Die gemeinschaftliche Selbsthilfe ist zudem gesetzlich verankert. Auch bei der Selbstvertretung denken wir an die gemeinschaftliche Selbstvertretung. Dazu gehört natürlich, dass wir pflegenden Angehörigen ein Selbstwertgefühl vermitteln, das sie häufig nicht haben, indem wir verdeutlichen, was sie unter anderem für eine gesamtgesellschaftliche wirtschaftliche Leistung erbringen. Ich verstehe die gemeinschaftliche Selbstvertretung als Mittelschritt zur Interessenvertretung. Wenn es ein gesamtgesellschaftliches Problem gibt, das nicht zu lösen ist, muss ich an die Politik gehen dürfen. Das darf bei pflegenden Angehörigen doch nicht infrage gestellt werden.
Haben Sie als Verbandsvertreter auch auf politischer Ebene Einfluss beziehungsweise wo werden Sie miteinbezogen?
Ja, wir pflegen e.V. wird zunehmend einbezogen. Wir haben beispielsweise erwirkt, dass es im Jahr 2023 beim Gesetz zur Unterstützung und Entlastung der Pflege (PUEG) bereits ab 2024 ein gemeinsames Budget aus Kurzzeit- und Verhinderungspflege für pflegende Eltern gibt. Zunächst war dies aus finanziellen Gründen zurückgestellt worden. Für alle anderen Pflegebedürftigen gibt es dieses gemeinsame Budget tatsächlich auch erst ab 2025.
Über die Sommermonate sind wir im Dialog mit Ministerien und Politikern. Und wir sind beispielsweise die erste Organisation als Vertretung pflegender Angehöriger, die eine Stellungnahme zum Bericht der Bundesregierung zur nachhaltigen Finanzierung der Pflege abgegeben hat.