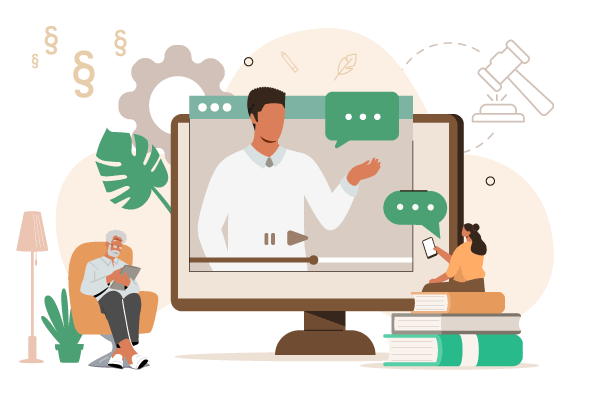Es kann schnell und plötzlich geschehen oder sich über einen längeren Zeitraum hinweg angekündigt haben: Unfall oder Krankheit können dafür sorgen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Wer vorab festlegen will, wie er in diesem Fall medizinisch versorgt werden will, kann eine Patientenverfügung verfassen. Wer sicherstellen will, dass jemand für deren Umsetzung eintritt und etwa auch finanzielle oder rechtliche Entscheidungen treffen darf, der kümmert sich rechtzeitig um eine Vorsorgevollmacht. Idealerweise lässt sich beides kombinieren – dann ist verbindlich festgehalten, was zu tun ist und wer zuständig ist.
Was aber tun, wenn niemand da ist, dem man entsprechend weitreichende Vollmachten erteilen möchte? Gerade die Vorsorgevollmacht, mit der unter anderem der Zugriff auf Bankkonten und Vermögenswerte geregelt werden kann, setzt ein hohes Maß an Vertrauen zwischen den Beteiligten voraus. Schließlich geht es um nicht weniger, als darum, sich im Fall der eigenen Handlungsunfähigkeit komplett auf einen anderen Menschen zu verlassen.
Wer sich nicht imstande sieht, eine Vorsorgevollmacht zu erteilen, dem bleibt noch eine weitere Möglichkeit: die Betreuungsverfügung.
Seit dem 1. Januar 2023 gilt das sogenannte Notvertretungsrecht für Ehe- und Lebenspartner. Damit dürfen diese in medizinischen Notfällen Entscheidungen treffen, auch wenn weder Patientenverfügung noch Vorsorgevollmacht vorliegen. Allerdings gilt dieses Notvertretungsrecht maximal für die Dauer von sechs Monaten. Anschließend muss ein Betreuungsgericht einen gesetzlichen Betreuer bestellen, der im Sinne des oder der Betroffenen Entscheidungen treffen darf. Dies sind häufig die nächsten oder nahen Verwandten, aber eben nicht automatisch.
Was ist eine Betreuungsverfügung?
Sollten Sie selbst nicht ansprechbar sein oder nicht fähig, ihren Willen klar und uneingeschränkt zum Ausdruck zu bringen, und liegt keine Vorsorgevollmacht vor, wird automatisch das Betreuungsgericht aktiv. Es muss dann einen rechtlichen Betreuer oder eine Betreuerin für Sie bestimmen, der oder die wiederum die Aufgabe hat, zu ermitteln, was in Ihrem Sinne wäre. Etwa ob Sie bestimmte medizinische Eingriffe wünschen würden (wenn keine Patientenverfügung vorliegt) oder wie Sie versorgt werden möchten. Zudem darf der rechtliche Betreuer Geldgeschäfte tätigen (z. B. Rechnungen bezahlen) oder behördliche Angelegenheiten regeln.
Rechtsgeschäfte allerdings, also etwa der Verkauf von Eigentum (Immobilien, Autos etc.), darf ein rechtlicher Betreuer nicht in Ihrem Namen tätigen. Hierfür wäre wiederum eine Vorsorgevollmacht notwendig.
Zudem unterliegt der rechtliche Betreuer, anders als der per Vorsorgevollmacht bestimmte Vertreter, automatisch der Kontrolle des Betreuungsgerichts.
Was regelt eine Betreuungsverfügung?
In einer Betreuungsverfügung können Sie festhalten, wer im Notfall zu Ihrem Betreuer oder Ihrer Betreuerin ernannt werden soll. Oder auch: Wen Sie keinesfalls als Betreuer oder Betreuerin haben möchten. Zudem können Sie genau darlegen, welche Vorstellungen und Wünsche Sie haben, was Sie ausschließen möchten oder ablehnen würden. Das gilt für Fragen Ihrer medizinischen und pflegerischen Versorgung (z. B. ob sie ambulant oder stationär untergebracht sein wollen), aber auch für andere Belange (z. B. wenn Sie vorab eine finanzielle Schenkung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Anlass an eine bestimmte Person festschreiben möchten). Grundsätzlich gilt auch hier: Je konkreter und verständlicher Sie die Verfügung formulieren, desto besser.
Was ist der Unterschied zu einer Vorsorgevollmacht?
Der wesentliche Unterschied zwischen Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung liegt darin, dass Sie die Vorsorgevollmacht jederzeit und nach eigenen Wünschen erteilen oder (sofern Sie noch geschäftsfähig sind) auch widerrufen können. Die Betreuungsverfügung hingegen muss, um die gewünschte Wirkung zu erzielen, sozusagen vom Betreuungsgericht bestätigt werden: Nur dieses kann den rechtlichen oder gesetzlichen Betreuer formal einsetzen. Das Gericht muss sich aber an das von Ihnen Verfügte halten.
In der Folge unterliegt der rechtliche Betreuer allerdings auch automatisch der Kontrolle durch das Betreuungsgericht. Das schließt Missbrauch nicht gänzlich aus, erschwert ihn aber erheblich. Bei der Vorsorgevollmacht hingegen erfolgt keine automatische Kontrolle, weshalb das Risiko für einen Missbrauch der eingeräumten Vollmacht hier höher ist. Sollten Sie jemandem also grundsätzlich zutrauen, Entscheidungen in Ihrem Sinne treffen zu können, aber vielleicht nicht vollends vertrauen, könnte die Betreuungsverfügung das Mittel der Wahl sein.
Auch wenn Sie eine Vorsorgevollmacht besitzen, kann es sinnvoll sein, zusätzlich eine Betreuungsverfügung aufzusetzen, um weitere Vertretungspersonen zu benennen. So kann es sein, dass die in der Vorsorgevollmacht benannte Person bereits verstorben ist oder selbst betreut wird. Dann hat das Betreuungsgericht die Möglichkeit, eine Ersatzperson zu ermitteln. Mehr dazu erfahren Sie in unserem kostenfreien Online-Pflegekurs „Rechtliche Vorsorge“.
Offiziell registrierte Betreuungsverfügungen
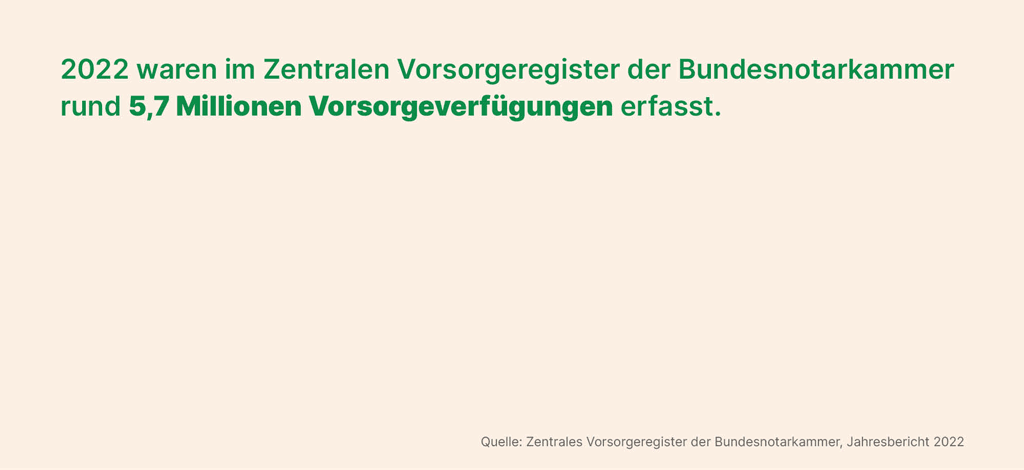
Welche Form muss eine Betreuungsverfügung haben?
Auch für die Betreuungsverfügung gibt – ähnlich wie für Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht – sehr gute und rechtssichere Vorlagen, die Sie nutzen können. So hält das Bundesjustizministerium auf seinen Internetseiten benutzerfreundliche, weil sehr einfach zu verstehende und nicht unnötig lange Formulare bereit, zudem noch in mehreren Sprachen. Eine gute Alternative ist das Online-Tool der Verbraucherzentralen, das Sie mit guten Informationen in einem strukturierten Prozess durch die Erstellung einer Betreuungsverfügung leitet.
Für zusätzliche Sicherheit sorgt die Beurkundung oder Beglaubigung durch öffentliche Stellen oder einen Notar.
Wie wird die Betreuungsverfügung aufbewahrt?
Es handelt sich bei der Betreuungsverfügung um ein wichtiges Dokument, das Sie zwar sicher (gegen Verschmutzung, Beschädigung oder versehentliche Entsorgung), aber gleichzeitig gut auffindbar verwahren sollten. Schließlich nutzt die Verfügung nichts, wenn sie im Ernstfall nicht vorliegt, weil niemand sie finden kann.
Eine Möglichkeit ist die Registrierung im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer. Dort können medizinische Einrichtungen, die nicht ansprechbare oder entscheidungsfähige Patienten in ihrer Obhut haben, abfragen, ob für die betreffende Person Vollmachten oder Verfügungen vorliegen.
Anfragen von Betreuungsgerichten
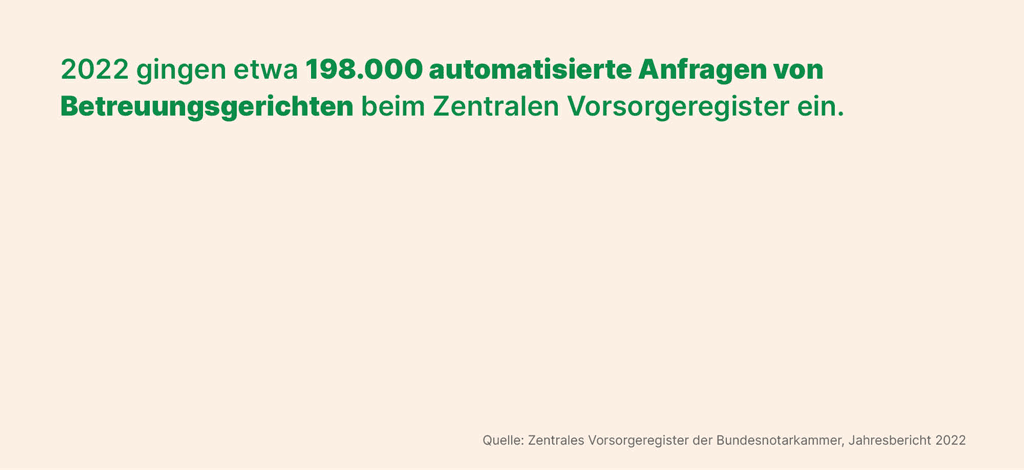
Eine andere Möglichkeit ist die Aufbewahrung bei einem Notar oder einer anderen Person Ihres Vertrauens, beispielsweise Ihrem Hausarzt. Für diesen Fall ist es sinnvoll, zusätzlich eine sogenannte Notfall- oder Vorsorgekarte mit sich zu führen, in der die entsprechende Person, Praxis oder Kanzlei als Kontaktperson für den Notfall aufgeführt ist. Auch so können Sie sicherstellen, dass Ihre Betreuungsverfügung im Ernstfall dem Betreuungsgericht vorliegt.
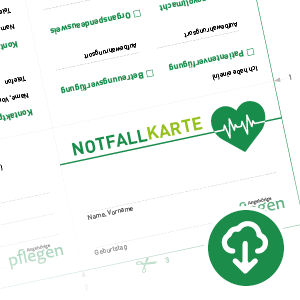
Notfallkarte fürs Portemonnaie
Tragen Sie wichtige Informationen, etwa welche Vorsorgedokumente vorliegen und wer zu informieren ist, immer bei sich - mit unserer taschengerechten Notfallkarte.
Ab wann und wie lange gilt eine Betreuungsverfügung?
Grundsätzlich können Sie eine Betreuungsverfügung jederzeit verfassen, sofern Sie volljährig und voll geschäftsfähig sind. Sie wird erst dann wirksam, wenn Sie nicht mehr selbst handlungs- oder entscheidungsfähig (im Sinne der Geschäftsfähigkeit) sind. Bis zu diesem Zeitpunkt kann sie jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Verlangen Sie dafür ausgehändigte Originale oder Kopien zurück und vernichten Sie diese entweder oder machen Sie – gerade auch falls nicht alle Kopien auffindbar sind – einen deutlichen Vermerk über den Widerruf. Unterzeichnen Sie diesen mit Angabe von Ort und Datum.