Bei Diabetikern sind der Stoffwechsel und häufig auch die Durchblutung gestört. Diese beiden Faktoren machen die Haut anfälliger für Verletzungen und senken gleichzeitig ihre Fähigkeit, kleine Verletzungen auch wieder gut zu heilen. Die Folge sind häufig chronische Wunden.
Was ist ein diabetisches Fußsyndrom?
Das diabetische Fußsyndrom tritt meist nach langjähriger Diabetes-Erkrankung auf und kann zu schweren chronischen Wunden führen, die in den schlimmsten Fällen nicht mehr geheilt werden können und daher eine Amputation erforderlich machen.
Wie entsteht ein diabetisches Fußsyndrom?
Die Basis für das diabetische Fußsyndrom ist der chronisch gestörte Stoffwechsel bei Diabetes, wodurch die Nerven beziehungsweise die Blutgefäße stark geschädigt werden können, medizinisch ist dann von einer „Polyneuropathie“ beziehungsweise einer „Angiopathie“ die Rede. Auch das Immunsystem wird durch den Diabetes angegriffen und funktioniert nicht mehr so wie bei gesunden Menschen.
Polyneuropathie: Störung der Reizweiterleitung der Nerven, wodurch Signale des Gehirns nicht mehr zuverlässig an Muskeln oder Organe weitergeleitet werden.
Angiopathie (bei Diabetes): Schädigungen bzw. Verengungen der arteriellen Blutgefäße durch Ablagerungen.
Die Veränderungen von Nerven, Blutgefäßen und Immunsystem führen insgesamt dazu, dass die Haut nach einigen Jahren deutlich anfälliger für Verletzungen wird. Aufgrund der geschädigten Nerven werden diese kleinen Verletzungen allerdings erst viel später wahrgenommen: Beispielsweise spüren die Betroffenen kleine Druckstellen, Blasen oder Schnitte am Fuß nicht mehr, oder sie laufen den ganzen Tag mit einem Stein im Schuh, ohne es zu merken. Das bedeutet, die Wunden sind meist schon ausgeprägter, wenn sie letztlich bemerkt und behandelt werden.
Die Nervenschädigung hat außerdem eine stark reduzierte Schweißproduktion zur Folge, die auch die Füße betrifft. Das klingt im ersten Moment gut, kann aber schwere Konsequenzen haben: Die Füße trocknen stark aus, besonders an der Ferse bilden sich Einrisse, über die Bakterien nun relativ leicht in den Körper gelangen können.
Wegen des beeinträchtigten Immunsystems und der geschädigten Blutgefäße wiederum kommt es häufiger zu Infektionen der Haut. Auch die Wundheilung ist im Vergleich zu gesunden Menschen deutlich verzögert.
Da die Beine und vor allem die Füße besonders von diesen Veränderungen betroffen sind, sollten Diabetiker und ihre Angehörigen die Fußpflege sehr ernst nehmen.
Woran ist das diabetische Fußsyndrom zu erkennen?
Charakteristisch für das diabetische Fußsyndrom ist das vermehrte Auftreten von offenen Wunden, die schlecht heilen, sich infizieren und – im schlimmsten Fall – sogar das Gewebe beziehungsweise die Knochen angreifen können.
Folgende Symptome am Fuß können auf ein DFS hinweisen:
- blasse Haut
- geringere Wahrnehmung von Schmerzen
- Taubheitsgefühl oder Kribbeln („Ameisenlaufen“)
- bläuliche, rote oder sogar schwarze Flecken
- Blutergüsse, Druckstellen
Ein weiteres Warnzeichen sind Deformationen der Zehen oder des gesamtes Fußes, denn durch die gestörte Reizweiterleitung der Nerven kann es zu Fehlbelastungen oder Veränderungen der Muskulatur kommen. Das wirkt sich auf die Druckbelastung aus und kann etwa zur Bildung von sehr fester Hornhaut unter dem Vorfuß, dem Ballen, führen, durch deren Aufreißen wiederum eine Wunde entstehen kann.
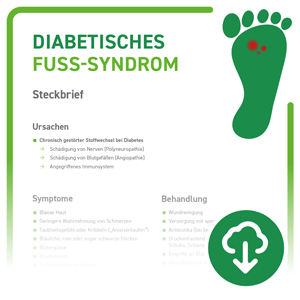
Steckbrief
Erfahren Sie in unserem Steckbrief, was die Ursachen, Symptome und Behandlungs- sowie Präventionsmöglichkeiten bei einem diabetischen Fußsyndrom sind.
Wie lässt sich einem diabetischen Fußsyndrom vorbeugen?
Die Grundkrankheit – also der Diabetes – sollte so weit wie möglich kontrolliert, die Blutzuckerwerte also gut eingestellt sein; hohe Blutfettwerte und Bluthochdruck können die Blutgefäße noch zusätzlich schädigen und sind daher ebenfalls möglichst gut zu behandeln.
Inspektion: Diabetes-Patienten und ihre Angehörigen sollten die Füße der Betroffenen täglich auf Druckstellen, Verletzungen oder andere Veränderungen kontrollieren (lassen); mindestens einmal jährlich ist zudem eine ärztliche Untersuchung anzuraten (auch wenn die Füße bisher unauffällig waren!).
Die tägliche Pflege umfasst ein (kurzes) Waschen der Füße mit rückfettenden Seifen (nicht so lange, dass die Haut aufweicht, und das Wasser sollte nicht über 37 °C warm sein). Die Füße sorgfältig und vorsichtig abtrocknen, damit keine Verletzungen entstehen oder nasse Stellen übrig bleiben (hier droht Fußpilzgefahr). Die Haut nach dem Waschen eincremen, dabei die Zehenzwischenräume auslassen (nochmals Fußpilzgefahr). Achtung: Keine Scheren oder spitze Fußzangen zum Kürzen der Zehennägel verwenden, die Verletzungsgefahr ist zu groß. Empfohlen wird stattdessen die Verwendung einer Sandpapierfeile.
Regelmäßige Fußgymnastik fördert die Bewegung und die Durchblutung der Füße.
Auf gutes Schuhwerk achten, mit ausreichend Platz, um Druckstellen zu vermeiden. Tipp: Schuhe immer am Nachmittag kaufen, der Fuß schwillt im Laufe des Tages an (auch bei Gesunden!). In Fachgeschäften können Sie sich zu orthopädischen Schuhen oder speziell maßgefertigten Einlagen beraten lassen.
Nicht rauchen, nicht barfuß laufen (vor allem im Freien).
Strümpfe sollten keine Falten werfen, nicht einschnüren und keine Nähte haben.
Temperaturextreme sind unbedingt zu vermeiden, also z. B. nicht in heißem Sand herumlaufen oder in offenen Schuhen im Winter spazieren gehen.
Hat Ihr Angehöriger Probleme mit den Füßen, ist zunächst ein Besuch beim Podologen oder der Podologin zu empfehlen: Die Fachleute für Fußpflege sind diabetisch geschult und können auch darüber Auskunft geben, ob ein Arzttermin erforderlich ist.
- Rund eine Million Menschen sind in Deutschland betroffen, das heißt, circa jeder vierte bis jeder dritte Mensch mit Diabetes erkrankt daran.
- Der „diabetische Fuß“ gilt als eine der schwerwiegendsten Langzeitkomplikationen des Diabetes, hierzulande werden mehr als 50 Prozent aller Operationen bei Menschen mit Diabetes wegen dieser Probleme am Fuß durchgeführt.
- Pro Jahr müssen aufgrund des diabetischen Fußsyndroms in Deutschland bis zu 50.000 Amputationen im Fuß- und Unterschenkelbereich vorgenommen werden.
Welche Möglichkeiten der Behandlung gibt es für das diabetische Fußsyndrom?
Tritt einmal eine Wunde auf, ist das Wichtigste, sie möglichst früh zu erkennen und zu behandeln. So kann verhindert werden, dass sie chronisch wird. Die Wunde wird gereinigt und mit speziellen Wundauflagen bedeckt, die die Heilung fördern.
Hat sich das Gewebe bereits entzündet, kommen häufig Antibiotika zum Einsatz, damit sich die Entzündung nicht im ganzen Körper ausbreitet.
Zudem gibt es Eingriffe zur Druckentlastung des diabetischen Fußes mit speziellen Schuhen, Schienen oder Gehstützen; auch ein Rollstuhl kann manchmal für eine gewisse Zeit erforderlich sein. Je nach Situation wird in einigen Fällen außerdem versucht, die Durchblutung zu verbessern, etwa durch Eingriffe an Blutgefäßen: Dazu zählt zum Beispiel eine Gefäßerweiterung oder das Anlegen einer neuen Gefäßverbindung rund um eine Engstelle der Blutgefäße.
In den allerschwersten Fällen ist es allerdings nicht mehr möglich, das diabetische Fußsyndrom zu heilen und eine Amputation des Fußes ist erforderlich.
Das diabetische Fußsyndrom ist also insgesamt keine leichte Erkrankung, die Behandlung kann länger dauern und anstrengend sein. Umso wichtiger ist es daher, vorzubeugen und die Haut immer wieder genau anzusehen, sie außerdem regelmäßig ärztlich untersuchen zu lassen und bei Anzeichen einer nicht heilenden Wunde zeitnah die Hilfe von Experten zu suchen.

E-Paper: Leben mit chronischen Wunden
Unser E-Paper "Chronische Wunden: vorsorgen, erkennen, behandeln" bietet alles Wichtige zum Thema auch noch einmal gebündelt und verständlich aufbereitet.


