84 Prozent der Pflegebedürftigen in Deutschland werden ambulant, das heißt in den eigenen vier Wänden, versorgt. So steht es in der offiziellen Pflegestatistik, die sich auf Daten vom Jahresende 2021 stützt. Bei rund 21 Prozent übernehmen ambulante Pflegedienste zumindest einen Teil der Versorgung, 52 Prozent werden ausschließlich durch ihnen nahestehende Menschen, durch Ehe- oder Lebenspartner, Geschwister, Kinder oder auch Enkelkinder gepflegt. Nicht ohne Grund werden pflegende Angehörige immer häufiger auch als „größter Pflegedienst Deutschlands“ bezeichnet.
Versorgungssituation Pflegebedürftiger in Deutschland


Dabei wird die Aufgabe, die sie in der und für die Gesellschaft schultern, in den nächsten Jahren noch bedeutender werden: Durch die Alterung der Gesellschaft wird die Pflegebedürftigkeit weiter zunehmen, während der Mangel an Fachkräften schon heute nirgends so ausgeprägt ist wie in der professionellen Kranken- und Altenpflege. Experten warnen deshalb bereits seit Jahren vor der Überlastung und dem Kollaps dieses „informellen“ Versorgungssystems aus Freiwilligen. Denn wer Angehörige pflegt, tut dies erstens unentgeltlich, was Staat und Versorgungssysteme entlastet, aber nicht die Pflegenden selbst, und zweitens mit einer ganzen Reihe spürbarer Konsequenzen für sich selbst.
Pflege Angehöriger wirkt sich auf eigene Gesundheit aus
So gaben in einer Befragung des Sozialverbandes VdK und der Hochschule Osnabrück mehr als die Hälfte der häuslich Pflegenden an, die eigene Gesundheit zu vernachlässigen und im Alltag durch zusätzliche Schwierigkeiten – etwa die Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf oder auch sorgen um weitere Familienmitglieder – belastet zu sein. Ebenfalls mehr als die Hälfte leiden selbst täglich an körperlichen Beschwerden wie Schmerzen, Atemnot, ungewollten Gewichtsveränderungen, Herzklopfen, Schwindel oder Erkrankungen des Bewegungsapparates.
Ein Drittel hatte das Gefühl, den Anforderungen im Alltag nicht gerecht werden zu können, und berichtete von Antriebslosigkeit, Schlafproblemen, Freudlosigkeit oder Gereiztheit. Beinahe ein Fünftel verneinte die Aussage, im Alltag etwa durch angenehme Aktivitäten Freude zu empfinden. Beinahe zwei Drittel sahen sich nicht in der Lage, eigene Interessen wie Sport oder andere Hobbies verfolgen zu können.
Knapp die Hälfte fühlte sich zudem durch schwierige Verhaltensweisen der pflegebedürftigen Person belastet, und abermals beinahe zwei Drittel gaben an, den pflegebedürftigen Angehörigen keine Stunde allein lassen zu können.
Belastungssituation pflegender Angehöriger
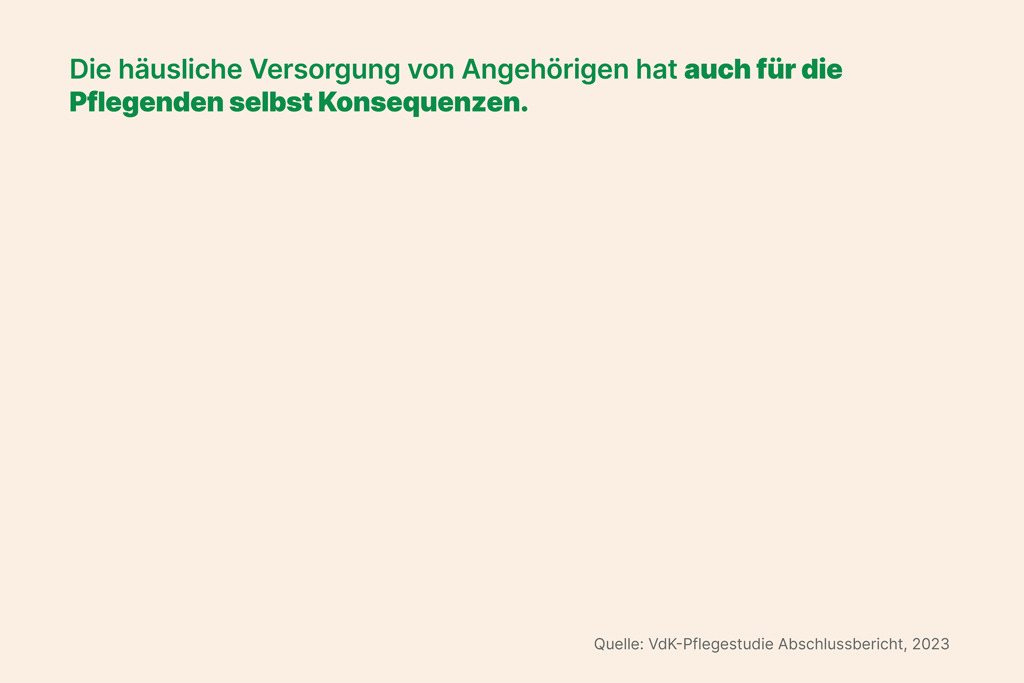
Weniger Beruf heißt auch weniger Lohn
Parallel hatte knapp die Hälfte der vom VdK Befragten ihre Arbeitszeit reduziert, um die Eltern, Partner oder auch die eigenen Kinder pflegen zu können – ohne Kompensation für den Verdienstausfall. Knapp jeder Zweite reduzierte um 25 Prozent der vorherigen Arbeitszeit, ein knappes Drittel um 50 Prozent. Der Rest reduzierte um mehr als 50 Prozent oder sah sich gezwungen, die Berufstätigkeit ganz aufzugeben.
Den aus der Arbeitszeitreduzierung folgenden monatlichen Verdienstausfall bezifferten 74 Prozent auf bis zu 1.000 Euro, 21 Prozent auf bis zu 2.000 Euro und 5 Prozent auf mehr als 2.000 Euro. Von den Befragten, deren Einkommen unter 2.000 Euro lag, gaben 55 Prozent an, von ständigen finanziellen Sorgen geplagt zu werden.
Verdienstausfälle spielen auch im Zusammenhang mit Möglichkeiten zur Freistellung durch den Arbeitgeber eine Rolle: 29 Prozent schlugen diese nach eigenen Angaben aus, weil sie einen zu großen Einkommensverlust bedeutet hätten. Und auch insgesamt ist die am häufigsten genutzte Art der Freistellung die kurzzeitige Arbeitsverhinderung von bis zu 10 oder 20 Tagen (51 Prozent) – mit deutlichem Abstand auf die Freistellung als unbezahlter Urlaub (27 Prozent), die bis zu sechsmonatige Pflegezeit (18 Prozent) oder gar die Familienpflegezeit von bis zu 24 Monaten (13,9 Prozent). Allerdings gab die überwiegende Mehrheit der Befragten an, überhaupt keine Freistellungsmöglichkeiten zu nutzen. Neben dem Verdienstausfall spielten hier auch mangelnde Angebote der Arbeitgeber eine Rolle oder das Unwissen der Betroffenen um solche Möglichkeiten.
Pflege und Beruf: Verdienstausfall durch Erwerbsreduzierung

Reduzierung der Arbeitszeit kann sich auch später noch rächen
Dass die Pflege Angehöriger sich negativ auf Erwerbstätigkeit und Einkommen auswirken kann, belegt auch eine Auswertung des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Informationstechnik (FIT) zur „Informellen Pflege“. Zwar gebe es Fälle, in denen die Arbeitszeit mit Beginn der Pflegetätigkeit erhöht wird. (Wobei es interessant wäre, zu erfahren, ob nicht auch hier die Sorge vor finanziellen Belastungen ein Grund für das Aufstocken der Erwerbstätigkeit ist.) Vielfach werde die Arbeitszeit aber eben doch verringert.
Dies hätten zwischen 2001 und 2020 etwa 12 Prozent der zuvor in Vollzeit Tätigen getan, 13 Prozent der in Teilzeit Erwerbstätigen und 21 Prozent der zuvor unregelmäßig oder geringfügig Beschäftigten. Nach Beendigung der Pflegetätigkeit könne dies den pflegenden Angehörigen aber Probleme bereiten, etwa die Rückkehr in den Beruf erschweren oder zu verringerten Löhnen führen, so die Autorinnen der Auswertung des Fraunhofer-Instituts. Durchaus ein Problem mit Tragweite, denn rund 11 Prozent der Teilzeitbeschäftigten, 24 Prozent der unregelmäßig oder geringfügig Beschäftigten und 25 Prozent der Nichterwerbstätigen wollten laut der FIT-Auswertung im Jahr nach Beenden der Pflegetätigkeit wieder mehr arbeiten.
Und auch sonst verrät die als Diskussionsgrundlage gedachte Zusammenfassung des FIT einiges darüber, wie es um den Erwerbsstatus pflegender Angehöriger oder eben „informell Pflegender“ bestellt ist: Nur gut drei Viertel der prinzipiell erwerbsfähigen unter ihnen (also Personen bis 65 Jahre, die keine Rente beziehen) sind auch tatsächlich erwerbstätig – im Schnitt etwa 33 Stunden pro Woche und mit einem monatlichen Nettoeinkommen von 1.960 Euro. Allerdings ist ein signifikanter Unterschied zwischen den Geschlechtern festzustellen.
Frauen: häufiger betroffen und besonders benachteiligt
61 Prozent der informell Pflegenden sind Frauen. Drei Viertel von ihnen sind daneben weiter berufstätig, und das obwohl ihr Pflegeaufwand höher ist als der erwerbstätiger pflegender Männer (im Schnitt 2,3 gegenüber 1,4 Stunden pro Werktag). Gleichzeitig liegen die Erwerbszeiten deutlich niedriger (im Schnitt 29,1 gegenüber 39,5 Arbeitsstunden pro Woche) und fällt – wenig überraschend – auch das monatliche Nettoeinkommen mit durchschnittlich 1.530 Euro deutlich geringer aus als das männlicher pflegender Angehöriger (2.620 Euro).
Mit anderen Worten: Frauen pflegen mehr, arbeiten weniger und verdienen weniger. Das wirkt sich nicht nur in der Gegenwart, sondern auch auf die Zukunft aus, denn geringeres Einkommen und geringere Erwerbszeiten wirken sich auf die späteren Rentenansprüche aus.
Diese besondere Benachteiligung von Frauen durch die Pflege Angehöriger belegt auch eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Jeder fünfte pflegende Angehörige ist demnach armutsgefährdet, unter den Frauen sogar jede vierte.
"Gender Gap" in der Angehörigenpflege

Sozialverband fordert Lohnersatzleistung und Rentenpunkte
Der Sozialverband VdK fordert deshalb schon länger eine eigene finanzielle Leistung für die Zeit der Pflegetätigkeit, deren Höhe sich nach dem tatsächlichen Aufwand richtet. Im Gegensatz zu einer Lohnersatzleistung auf Basis des vorherigen Einkommens führe dies auch nicht zu einer Benachteiligung von Geringverdienern. Zudem müssten pflegende Angehörige für ihre Leistung Rentenpunkte erhalten. Denn durch die Reduzierung oder Aufgabe der Erwerbstätigkeit fehlten ihnen diese sonst später, sodass sie im Alter sogar noch für die Pflege ihrer Angehörigen bestraft würden.
Ebenfalls auf dem Tisch liegen Empfehlungen des vom Bundesfamilienministerium eingesetzten unabhängigen Beirats für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Das mit Experten aus Politik, Wissenschaft, Sozial- und Wohlfahrts- sowie Berufs- und Interessensverbänden besetzte Gremium hatte sich bereits im letzten Sommer mit einem Teilbericht zu Wort gemeldet und für eine neue Familienpflegezeit und ein Familienpflegegeld ausgesprochen. Im Juni dieses Jahres folgten weitere Empfehlungen und die Zusammenführung in einem umfassenderen Bericht.
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf: Beirat empfiehlt Reformen
Im Kern soll die Familienpflegezeit auf 36 Monate ausgedehnt werden, von denen bis zu sechs Monaten als vollständige oder teilweise Freistellung auch unter 15 Stunden Wochenarbeitszeit genommen werden können, die restlichen Monate als teilweise Freistellung bei mindestens 15 Stunden Wochenarbeitszeit. Das neu einzuführende Familienpflegegeld, eine steuerfinanzierte Lohnersatzleistung, solle gleichermaßen für eine Dauer von bis zu 36 Monaten bezogen werden können. Entgegen den Vorschlägen des VdK soll dieses aber einkommensabhängig sein und in Höhe und Berechnung den Regelungen zum Elterngeld entsprechen.
Ausgeweitet werden soll nach dem Wunsch des Beirats die Gruppe der Anspruchsberechtigten: Künftig sollen Leistungen nicht mehr nur pflegenden Familienmitgliedern zustehen, sondern auch „nahestehenden Personen, die die Pflege übernehmen“. Zudem soll der Nachweis einer solchen Berechtigung unbürokratisch durch die pflegebedürftigen Personen selbst oder legitimierte Dritte (wie Eltern, Geschwister, Kinder oder andere Bevollmächtigte) erfolgen können.
Sorgearbeit anerkennen – unabhängig von individuellen Lebensformen
Grundsätzlich folgte der Beirat nach eigenen Angaben dem Leitgedanken, die Sorgearbeit für Nahestehende anzuerkennen – und zwar unabhängig von den individuellen Lebensformen und Verwandtschaftsverhältnissen. Gerade auch erwerbstätigen Menschen müsse ermöglicht werden, sich um Nahestehende zu kümmern, ohne selbst in finanzielle Not zu geraten. Vor diesem Hintergrund sei die Förderung einer geschlechtergerechten Aufteilung der Pflegeübernahme ein besonderes Anliegen, denn nach wie vor erbrächten Frauen die „Hauptpflegeleistung“.
Neben Familienpflegezeit und -geld bedürfe es weiterer Bausteine, um die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zu verbessern. Dazu zähle etwa, dass Pflegehaushalte „unbürokratisch und zeitnah auf bedarfsgerechte, aufeinander abgestimmte und öffentlich zugängliche Hilfen und Strukturen zugreifen können“, professionelle und private Pflege besser miteinander verzahnt und rechtssichere Grundlagen für die Betreuung im häuslichen Umfeld (24-Stunden-Betreuung) geschaffen würden. Zudem müsse im Rahmen der aufsuchenden Beratung zur häuslichen Pflege auch über mittel- und langfristige Folgen für erwerbstätige pflegende Angehörige, etwa für ihre Gesundheit und soziale Absicherung, informiert werden.
Papier ist geduldig: Was macht die Politik?
Dass immer mehr Menschen in Deutschland vor der Herausforderung stehen, die Pflege von Angehörigen und die eigene Berufstätigkeit unter einen Hut bringen zu müssen, formuliert auch der Beirat explizit in seinem jüngsten Bericht und betont, dass es mit Einzelmaßnahmen nicht getan ist. Papier aber ist geduldig. Es bleibt abzuwarten, ob aus den vielen Erkenntnissen und Schlussfolgerungen auch etwas Konkretes folgen wird.
Im Juli dieses Jahres hat der Beirat seinen Bericht an Bundesfamilienministerin Paus (SPD) übergeben. Die bezeichnete die Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf als „eine große gesellschaftspolitische Aufgabe“ und „zentralen Baustein zur Eindämmung der Pflegekrise“. Sie gehöre deshalb zu ihren wichtigsten Vorhaben. Ihr Haus arbeite aktuell an einer grundlegenden Reform, damit pflegende Angehörige und Nahestehende weiter berufstätig sein könnten, ohne von Altersarmut gefährdet zu sein.
Bis wann diese Reform erarbeitet werden soll, verriet sie allerdings nicht. Auch nicht, welche Empfehlungen des Beirats es vielleicht in einen entsprechenden Entwurf schaffen könnten. Sie wolle „in engem Austausch“ mit dem Beirat bleiben.
Wenn pflegende Angehörige auch künftig die tragende Säule der pflegerischen Versorgung bleiben sollen, wird es mehr brauchen als Empfehlungen. Hoffen wir, dass auf Worte Taten folgen.

