Die Diagnose Parkinson ist meist ein Schock, ist die – im Volksmund auch als Schüttellähmung bekannte – Krankheit doch noch immer nicht heilbar. Es gibt aber große Forschungsanstrengungen, neue Medikamente auf den Markt zu bringen, und auch die Erkenntnis, dass jeder von uns etwas für die Prävention tun kann: Die Schlagwörter sind hier wie so oft Bewegung und Ernährung. In der Folge dieser Entwicklungen ist die Lebenserwartung heutzutage weitgehend normal.
Verbreitung: Wann und wie häufig tritt Parkinson auf?
Die Parkinson-Krankheit ist mit rund 400.000 Betroffenen die zweithäufigste neurologische Erkrankung in Deutschland, nach der Alzheimer-Krankheit. Meist wird die Krankheit zwischen dem 55. und dem 60. Lebensjahr diagnostiziert, bei jedem zehnten Betroffenen allerdings noch vor dem 40. Lebensjahr. Im Schnitt erkranken etwa 1 bis 2 von 1.000 Menschen, wobei Männer rund anderthalbmal häufiger betroffen sind als Frauen. Der Grund dafür ist nicht bekannt.
Parkinson weltweit
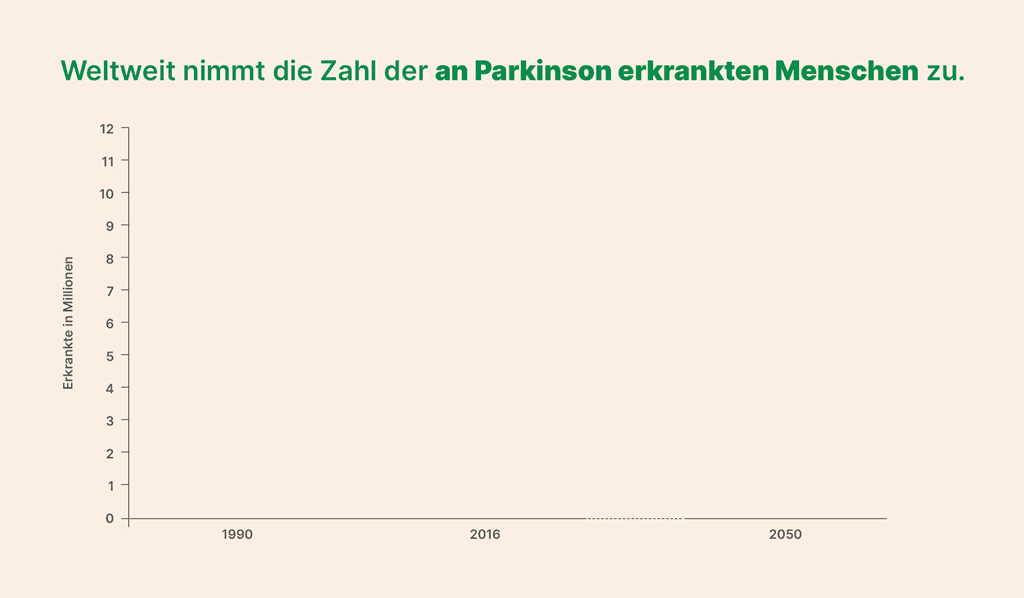

Ursachen: Ist die Parkinson-Krankheit genetisch bedingt?
Die grundlegende Störung der Parkinson-Krankheit verursacht ein Eiweiß (Protein) im Gehirn, dass sich „falsch“ und damit „krankhaft“ faltet, sich dann in bestimmten Nervenzellen ablagert, was zum Absterben dieser führt (s. auch „Ernährung“ unten). Warum sich dieses Eiweiß falsch faltet, ist allerdings noch ungeklärt.
In der Mehrheit der Fälle (75 Prozent) ist die Erkrankung nicht erblich bedingt. In rund 25 Prozent der Fälle sind bestimmte Auslöser bekannt: Die Krankheit ist dann entweder genetisch vererbt und tritt frühzeitig auf (vor dem 40. Lebensjahr) oder sie wurde durch Umweltgifte oder eine andere Krankheit ausgelöst (z. B. Störungen von Durchblutung und Stoffwechsel). Menschen mit einem sogenannten „atypischen“ Parkinson wiederum leiden an einer anderen Krankheit, bei der sich ebenfalls Eiweiße krankhaft ablagern und Nervenzellen absterben; ein Beispiel hierfür ist die „Lewy-Körperchen-Erkrankung“.
Warnzeichen: Wie deutet sich die Parkinson-Krankheit an?
Der Beginn der Parkinson-Krankheit kann mit Fug und Recht als heimtückisch bezeichnet werden: Langsam und schleichend treten die Anzeichen auf, mit sehr allgemeinen Beschwerden wie Müdigkeit und Abgeschlagenheit, die nicht gleich oder nicht unbedingt mit Parkinson verbunden werden. Schmerzen in Nacken, Rücken, Armen oder Beinen wiederum werden häufig allgemein dem Älterwerden oder einer banaleren Muskel- oder Gelenkerkrankung zugeschrieben. Manche Betroffene sprechen leiser oder die Handschrift wird kleiner, und auch das Gesicht kann sich verändern: Es hat nun weniger Mimik und daher Ausdruck. In diesem Stadium ist es außerdem typisch, Hobbys zu vernachlässigen und sich ganz allgemein zurückzuziehen.
Achtung: Zu den frühen Warnzeichen für Parkinson zählen Riechstörungen sowie Schreien und Um-sich-Schlagen im Schlaf – wenn diese Symptome gemeinsam auftreten, sollte für die Abklärung ein Termin beim Facharzt oder bei der Fachärztin für Neurologie ausgemacht werden.
Symptome: Welche Beschwerden sind typisch für die Parkinson-Krankheit?
Erst bei Fortschreiten der Parkinson-Krankheit treten die besser bekannten, typischen Hauptbeschwerden zutage.
Bewegungsarmut gilt als das wichtigste Zeichen: Die Bewegungen der Betroffenen sind jetzt sehr langsam und reduziert. Damit ist ein Verlust der Spontaneität verbunden, da Bewegungen von Arm oder Bein eben erst nach einer gewissen Verzögerung möglich sind; alltägliche Routinen wie Anziehen dauern daher sehr viel länger, was auch psychologisch belastend ist.
Muskelsteife („Rigor“): Der ganze Körper fühlt sich steif und gleichzeitig schwach an, da eine Bewegung erst dann möglich ist, wenn diese Steifigkeit überwunden wird. Bekannt ist hier auch das sogenannte Zahnradphänomen: Bei dem Versuch, den Arm einer erkrankten Person zu strecken, kann der Arm nicht gleichmäßig bewegt werden, sondern die Bewegung erfolgt ruckartig – wie bei einem Zahnrad.
Muskelzittern („Tremor“) ist ein weiteres bekanntes Symptom. Es beginnt häufig in der Hand (bis zu neun Bewegungen der Finger pro Sekunde), aber auch Füße oder der Kiefer können als Erstes betroffen sein. Das Zittern lässt sich nicht unterdrücken – im Gegenteil, bei Stress ist der Tremor sogar noch stärker ausgeprägt.
Die gestörte Haltungsstabilität („posturale Instabilität“) gilt als ein sehr auffälliges Zeichen: Patientinnen und Patienten fällt es ausgesprochen schwer, sich aufrecht zu halten. Denn die Reflexe, mit denen gesunde Menschen ihre Körper automatisch ausbalancieren, sind durch die Parkinson-Krankheit gestört, sodass es den Erkrankten nicht mehr möglich ist, sich nach einer plötzlichen, unvorhergesehenen Bewegung „zu fangen“. Häufige Stürze sind die Folge.

Parkinson: Anzeichen und Symptome
Welche Anzeichen deuten auf eine Parkinson-Erkrankung hin? Welche Symptome treten typischerweise auf? Das Wichtigste auf einen Blick.
Was sind weitere Symptome und Folgen einer Parkinson-Krankheit?
Es gibt noch weitere Krankheitszeichen, die zwar alle typisch für Parkinson sind, aber individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt sein oder ganz fehlen können. Dazu zählen Veränderungen des Gefühlslebens – häufig wird auf Nichtigkeiten sehr gereizt reagiert oder eine depressive Stimmung kann eintreten – sowie ein Nachlassen geistiger Fähigkeiten oder Schlafstörungen.
In noch weiter fortgeschrittenen Stadien können weitere Beschwerden dazukommen: Blasenschwäche, Verstopfung, Schwankungen von Blutdruck und Körpertemperatur und bei Männern Erektionsprobleme.
Und: Ungefähr 40 Prozent der Patienten und Patientinnen mit Parkinson-Krankheit entwickeln eine Parkinson-Demenz. Diese entwickelt sich meist nach dem 70. Lebensjahr beziehungsweise rund zehn bis 15 Jahre nach der Diagnose.
Therapie: Welche Behandlung gibt es für die Parkinson-Krankheit?
Die medikamentöse Therapie ist schon seit Langem verfügbar. Bereits in den 1860er-Jahren kamen Tollkirsche-Präparate zum Einsatz: Deren Wirkstoff Atropin hemmt einen Botenstoff der Nervenzellen im Gehirn, das sogenannte Acetylcholin, das bei Parkinson im Übermaß vorhanden ist. Rund 100 Jahre später, in den 1960er-Jahren, entdeckte die Wissenschaft den verminderten Gehalt an Dopamin (ein weiterer Botenstoff) im Gehirn der Betroffenen. Diese Feststellung eröffnete den Weg für die Therapie mit L-Dopa, einer Vorstufe des fehlenden Dopamins.
Heute ist bekannt, dass Dopamin unerlässlich ist für die Feinabstimmung der Muskelbewegungen im Körper – der Mangel an Dopamin ist daher der wichtigste Faktor für die verlorene Kontrolle der Muskelbewegungen. Dopamin wird von den Zellen der sogenannten schwarzen Region im Gehirn (lat. „substantia nigra“) freigesetzt. Schon bei gesunden Menschen sterben jedes Jahr rund 2.400 der Zellen der Substantia nigra ab, durch eine Parkinson-Erkrankung ist der Abbau aber deutlich beschleunigt. Auch ist diese Gehirnregion bei den Betroffenen nicht (mehr) schwarz gefärbt, sondern ausgeblichen. Laut Studien müssen mehr als 60 Prozent der Substantia nigra absterben, bevor sich die typischen Parkinson-Symptome zeigen.
Heutzutage wird eine Kombination aus mehreren Medikamenten eingesetzt: Sie wirken ähnlich wie Dopamin (Dopamin-Agonisten) oder hemmen andere Botenstoffe, die vermehrt vorhanden sind. Die Tiefenhirnstimulation ist eine bewährte Methode, wobei über Elektroden im Gehirn elektrische Impulse gesetzt werden. Zusammen mit Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie können die Symptome gelindert und sowohl die Lebensqualität als auch die Lebenserwartung der Parkinson-Patientinnen und -Patienten deutlich verbessert werden. Die Lebenserwartung ist heute weitgehend normal, eine Heilung von Parkinson ist aber leider noch nicht möglich.
Weitere und vertiefende Informationen zu bereits verfügbaren oder auch in der Entwicklung befindlichen Therapieverfahren und Behandlungsoptionen bei Parkinson finden Sie in unserem Übersichtsartikel „Parkinson: Therapie jetzt und in der Zukunft“.
Der Name der Parkinson-Krankheit ist auf den Londoner Arzt und Apotheker James Parkinson zurückzuführen, der bereits 1817 eine „Abhandlung über die Schüttellähmung“ mit genauer Beschreibung der Symptome sowie deren langsamem Fortschreiten veröffentlichte; der Welt-Parkinson-Tag wird jährlich an seinem Geburtstag (11. April) abgehalten. Der Ausdruck „Morbus Parkinson“ (lat. Morbus = Krankheit) wurde erst 1884 vom französischen Psychiater Jean-Martin Charcot etabliert.
Prävention: Lässt sich Parkinson vorbeugen oder verlangsamen?
Für die Prävention gibt es einige neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft, die sich auf Bewegung und Ernährung beziehen.
- Offenbar kann Ausdauersport dem Abbau von körperlichen und geistigen Fähigkeiten bei Menschen mit Parkinson entgegenwirken: Mit Joggen, Schwimmen oder Nordic Walking können Betroffene also zumindest den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen.
- Die Ernährung scheint sogar für die Prävention der Krankheit selbst von Bedeutung zu sein. Der Zusammenhang ist zwar noch nicht restlos geklärt, aber möglicherweise geht das bei Parkinson wichtige, „falsch gefaltete“ Protein von der Darmflora aus (Darmflora = Gesamtheit der Bakterien im Darm) und wird dann über die vielen Verbindungen vom Darm an das Gehirn weitergegeben. Einige Forscher bezeichnen eine gesunde Darmflora bereits als wichtige Säule der Parkinson-Prävention.

Kostenfreies E-Paper: Parkinson
Parkinson verändert das Leben der Betroffenen und ihrer Familien. Laden Sie sich deshalb unser E-Paper mit praktischen Hilfestellungen für den Pflegealltag herunter.
Parkinson-Krankheit: Was macht Hoffnung für die Zukunft?
Untersucht werden neue Medikamente zur Verbesserung der Dopamin-Produktion im Gehirn, aber auch Antikörper, die sich beispielsweise gegen das oben erwähnte „falsch gefaltete“ Protein im Gehirn der Erkrankten richten. Die Erforschung der Stammzelltherapie zur Regeneration von geschädigtem Gehirngewebe ist ebenfalls im Gange. Ziel ist es, den Abbau der Dopamin-produzierenden Zellen zu verlangsamen oder sogar umzukehren.


