In Gesprächen berichten viele meiner Klienten von Ängsten. Die Bandbreite reicht von gelegentlichen Zukunftsängsten bis hin zu täglich wiederkehrenden Panikattacken. Doch welche Rolle spielen die unterschiedlichen Formen von Ängsten bei der Beurteilung von Pflegebedürftigkeit?
Panik im Pflegegrad
Wenn wir an Pflegebedürftigkeit denken, haben wir meistens das Bild einer gebrechlichen alten Dame vor Augen, die langsam mit Rollator durchs Wohnzimmer schleicht. Was uns nicht sofort einfällt: Dieselbe Dame verlässt das Haus seit Jahren nicht mehr – aus Angst. Angst vor der Straße, den Menschen, der Busfahrt. Und diese Angst? Die gehört ins Pflegegutachten. Oder?
In der Begutachtung gemäß SGB XI, insbesondere durch den Medizinischen Dienst (MD), geht es um Einschränkungen der Selbstständigkeit in 6 Lebensbereichen, darunter auch um die „Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte“. Klingt harmlos. Ist es aber nicht. Denn: Wer aufgrund von Ängsten seine Wohnung nicht verlässt, wer keine Termine mehr wahrnimmt oder nächtelang nicht schläft – hat ein reales Pflegeproblem. Nur: Die Realität kommt nicht immer im Gutachten an.
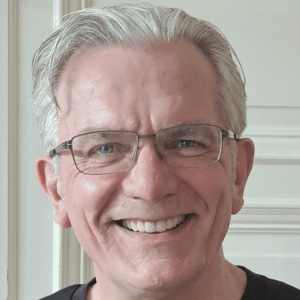
Dr. med. Jörg A. Zimmermann schreibt über die Gesetzliche Pflegeversicherung ‒ eine höchst subjektive ärztliche Zweitmeinung zu Diagnosen und Therapieversuchen in einem manchmal sehr kranken System. Er ist Arzt mit mehrjähriger klinischer Erfahrung. Mit seiner Firma Familiara hilft er Betroffenen, sich gegen ungerechtfertigte Entscheidungen der Pflegekassen zur Wehr zu setzen. Seit 2017 haben er und sein Team über 40.000 Fälle analysiert und mehrere tausend Widerspruchsverfahren in allen Phasen begleitet.
Phobien im Schatten der Pflegeversicherung
Das Pflegegradverfahren ist ein standardisierter Akt mit formellen Kriterien. Es orientiert sich an der Begutachtungsrichtlinie (BRi) des GKV-Spitzenverbands, welche explizit psychische Beeinträchtigungen berücksichtigt. Der Modulbereich 3 „Verhaltensweisen und psychische Problemlagen“ fragt konkret nach: Liegen ausgeprägte Angstzustände, Wahnvorstellungen oder nächtliche Unruhezustände vor? Und wie oft treten sie auf?
Doch hier beginnt das Drama: Nur was sich manifest, also wiederholt und regelmäßig zeigt, wird dokumentiert. Wer bei der Begutachtung den Eindruck erweckt, noch „klar im Kopf“ zu sein – etwa durch routiniertes Plaudern mit der Gutachterin –, wird schnell als psychisch unbelastet eingestuft. Dass der oder die Betroffene sich 3 Tage lang auf den Termin vorbereitet hat, schweißgebadet und schlaflos, zählt nicht. Phobien sind scheu – sie verstecken sich gut hinter höflichen Fassaden.

Nicht zu unterschätzen: Das Pflegetagebuch
Dokumentieren Sie den tatsächlichen Pflege- und Unterstützungsbedarf Ihres pflegebedürftigen Angehörigen und wappnen Sie sich für Begutachtungstermin oder Arztgespräch.
Das Recht auf Angst
Dass Ängste zu einer Pflegebedürftigkeit führen können, hat die Rechtsprechung durchaus anerkannt. Ein bemerkenswerter Fall ist das Urteil des Sozialgerichts Gießen vom 25.10.2018 (Az. S 7 P 18/17): Eine Frau litt unter einer schweren Angststörung mit Vermeidungsverhalten – sie konnte ohne Begleitung das Haus nicht verlassen, Arzttermine nicht allein wahrnehmen. Der MD hatte den Pflegegrad abgelehnt. Das Gericht hob die Entscheidung auf: Die Klägerin sei im Alltag erheblich eingeschränkt und damit pflegebedürftig im Sinne des Gesetzes.
Auch das Landessozialgericht Baden-Württemberg (Az. L 4 P 1259/18) bestätigte in einem anderen Urteil, dass Angststörungen mit sozialem Rückzug eine Pflegesituation begründen können – vor allem, wenn Angehörige regelmäßig eingreifen müssen.
Kindliche Ängste
Insbesondere bei pflegebedürftigen Kindern muss die Intervention der Eltern bei Angstzuständen als pflegerelevant gewertet werden. Das Landessozialgericht Schleswig-Holstein (Urteil vom 21. August 2023, Az. L 8 P 6/22) hat bestätigt: Die Spritzenphobie (Abwehr pflegerischer Maßnahmen) bei einem insulinpflichtigen Kind könne den Hilfebedarf im Alltag erheblich steigern – insbesondere, wenn das Kind wiederholt Unterstützung beim Insulingeben benötigt, weil es die Angst nicht selbst überwinden kann.
Das Bundessozialgericht (BSG) hat das Urteil später in einem verwandten Verfahren bestätigt (Az. B 3 P 9/23 R vom 12.12.2024), in dem es ausdrücklich darlegt, dass auch im Modul 3 Hilfebedarfe wegen ausgeprägter Abwehr pflegerischer Maßnahmen berücksichtigt werden müssen.
Fazit: Angst ist ein Pflegefaktor
Angststörungen, Phobien, Panikattacken – sie mögen unsichtbar sein, aber sie sind in ihrer Wirkung ebenso gravierend wie körperliche Gebrechen. Die Begutachtungsrichtlinien bieten prinzipiell Raum, sie zu erfassen. Aber dieser Raum muss bewusst genutzt werden. Wer still leidet und alles vermeidet, fällt durchs Raster.
Wichtig dabei: Die Angst und ihre Folgen muss immer die Hilfe einer anderen Person notwendig machen. Zukunfts- oder Existenzängste oder Alpträume, die in der Regel keine Intervention erfordern, werden nicht gewertet.

